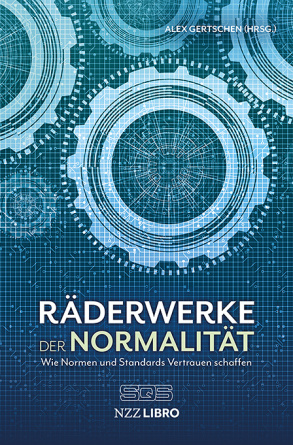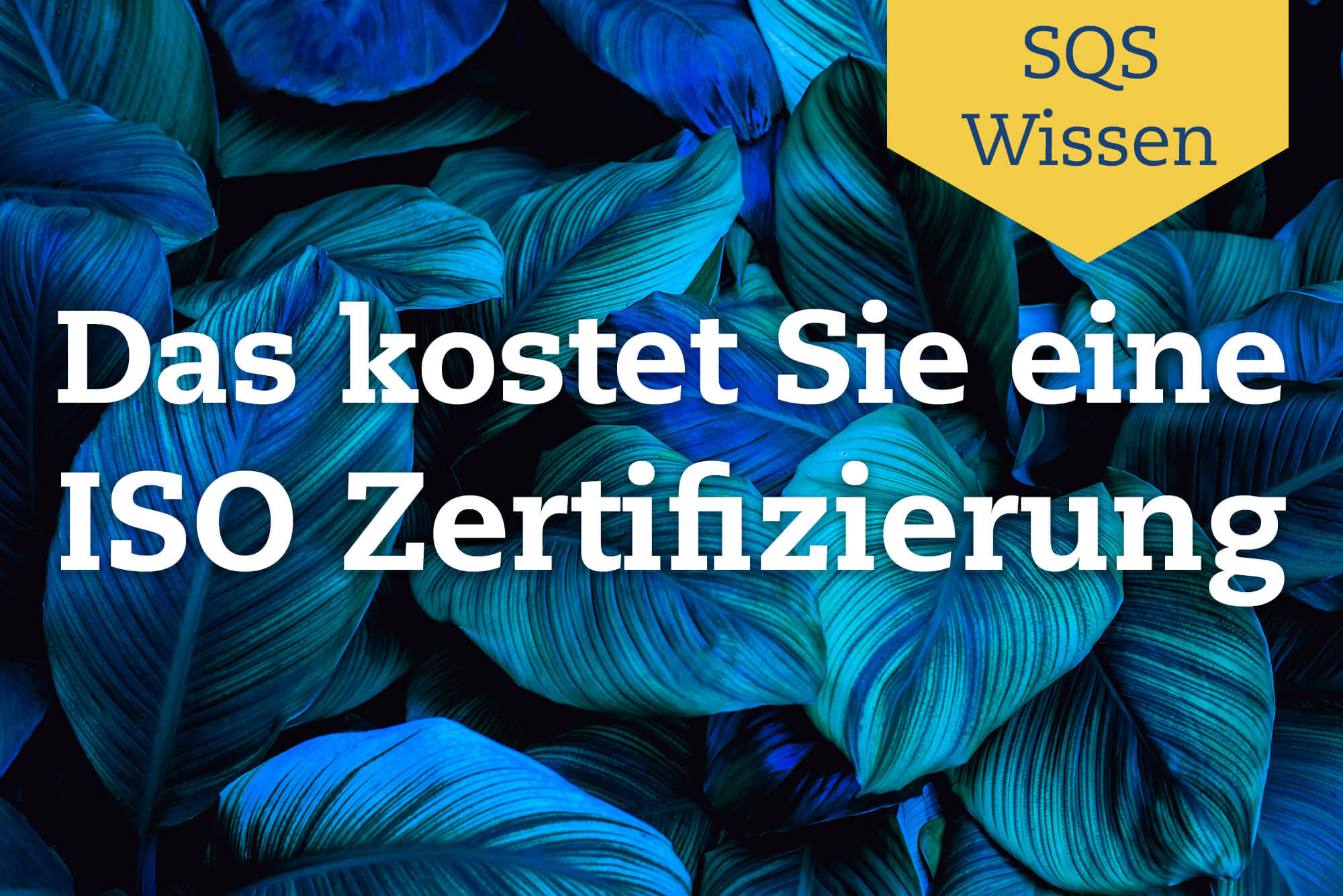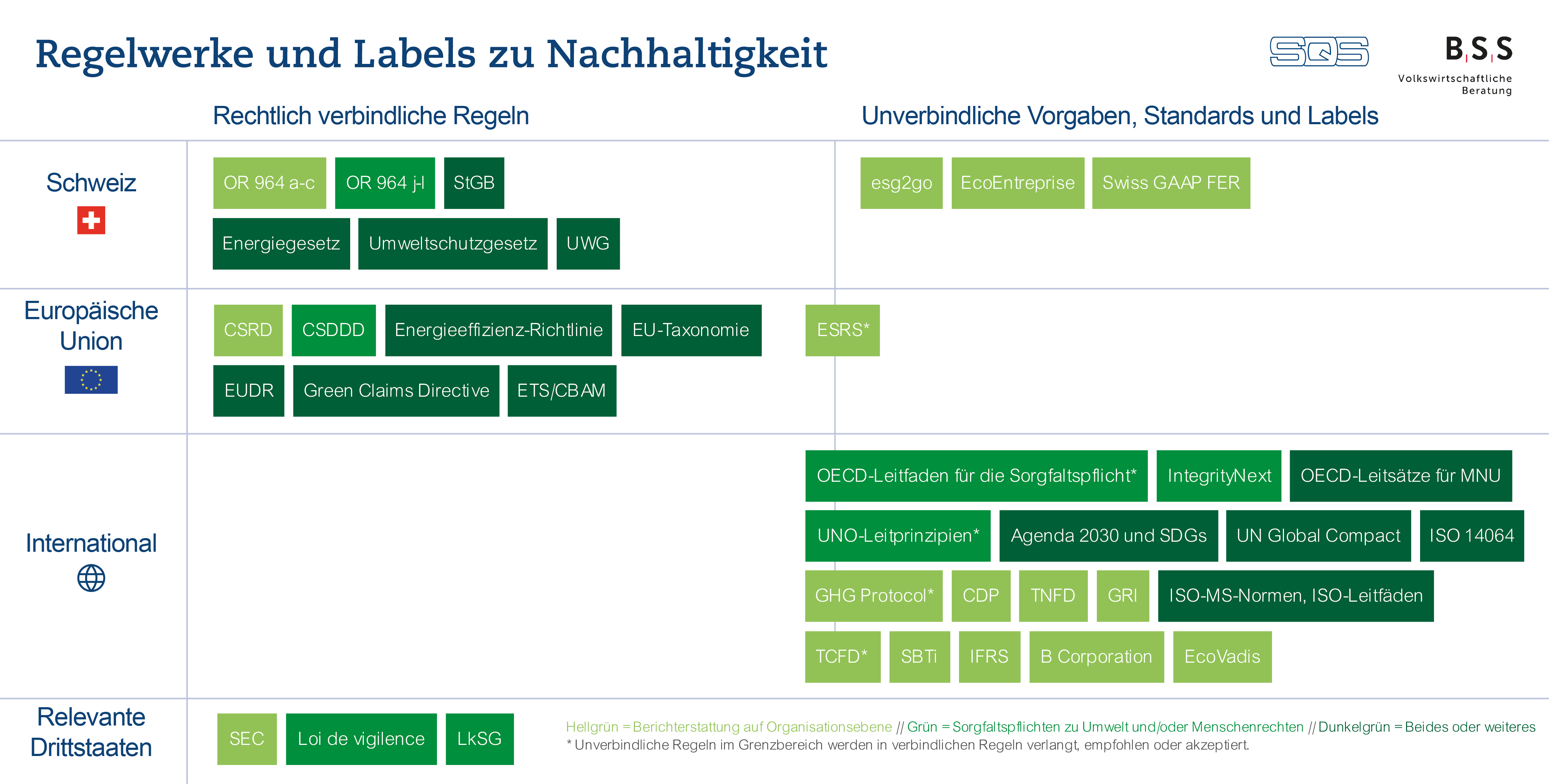Was ist schon normal? Die Paraplegiker-Stiftung pflegt einen kritischen und pragmatischen Umgang mit Normen
Veröffentlicht am: 15.02.2024
Lesedauer
ca. 7 Minuten
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist aus dem Widerstand gegen überkommene Vorstellungen des Normalen entstanden. Der kritische Umgang mit standardisierten Prozessen – und deren Auditierung – gehört deshalb zu ihrer DNA. Dennoch gibt es gute Gründe, warum sie ein SQS-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem betreibt.
Haupttext von Esther Diener-Morscher
Der junge Mann «gibt Gas» auf der Guido-A.-Zäch-Strasse. Er kurvt mit seinem Elektro-Rollstuhl über den Platz und biegt zur Eingangshalle des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil ab. Dort nimmt er die lange Rampe, die sich durch die Halle zieht, unter die Räder. Ein halbes Jahr zuvor hat ein Unfall innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde darüber entschieden, dass der junge Mann aus seiner gewohnten Normalität fiel und zum Paraplegiker wurde.
Mit Hilfe der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) versucht er nun, wieder zurück in ein «normales» Leben, zurück in eine neue Normalität zu finden. Der Mann ist einer von 1500 Menschen, die im Paraplegiker-Zentrum am Sempachersee jedes Jahr stationär behandelt und betreut werden.
In der Schweiz gibt es 50 Rehabilitations-Kliniken, die Verunfallte oder Kranke ins Alltagsleben zurückzubringen versuchen. Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) ist eine davon – und trotzdem keine wie alle anderen. Wäre alles normal verlaufen, wäre es heute immer noch ein Teil des Bürgerspitals Basel. Doch irgendwann im Verlauf der siebziger Jahre begann das SPZ einen anderen, unkonventionellen Weg zu nehmen – um zur heute grössten Schweizer Spezialklinik für Querschnittgelähmte zu werden.
Basel wollte «normale Familien»
Ein junger Assistenzarzt, der in den 1960er-Jahren für die Betreuung von Unfallopfern mit Querschnittlähmung verantwortlich war, wollte die Dinge, die damals als normal galten, ändern. Bis dahin mussten die Unfallopfer – oft junge Männer – zwei bis drei Jahre im Spital bleiben. Dann wurden sie in der Regel in ein Pflegeheim verlegt. In ihr Alltagsleben konnten die schwer Verunfallten meist nicht mehr zurückkehren. Der Assistenzarzt begann deshalb, ein eigenes Ziel zu verfolgen: Er wollte die Gelähmten wieder zurück ins Leben begleiten.
Guido A. Zäch hiess dieser Mann, der täglich die unwürdige Situation von Querschnittgelähmten sah und deshalb deren Behandlung in neue Bahnen lenken wollte. 1973 bekam er die Chance dazu. Er wurde Chefarzt des SPZ in Basel. Ihm schwebte eine Rundum-Versorgung und -Rehabilitation von querschnittgelähmten Menschen unter einem Dach vor – etwas, das man in der Schweiz nicht kannte und völlig von den geltenden Normen abwich. Das bekam der enthusiastische Chefarzt dann auch zu spüren, als er seine Pläne verwirklichen und das Paraplegiker-Zentrum in Basel ausbauen wollte.
Die Basler Regierung machte nicht mit. Sie wollte kein Heim für Querschnittgelähmte. Die Begründung für die ablehnende Haltung tönt heute befremdend: «Ganz allgemein müssen wir in Basel Wert auf die vermehrte Wiederansiedlung so genannter normaler Familien legen. Pflegebedürftige, alte, kranke und invalide Kantonseinwohner sind bereits in einem den gesamtschweizerischen Durchschnitt weit übersteigenden Masse vorhanden. Ihr weiterer Zuzug ist sicher nicht zu fördern», steht im Regierungsbeschluss vom 22. Februar 1977 zu lesen.
Unkonventionelle Anfänge
Guido A. Zäch wollte sich seine Pläne nicht durchkreuzen lassen und begann, nach einem neuen Standort zu suchen. Aber auch andernorts stiess er auf vorgefasste – «normierte» – Meinungen und dadurch auf Ablehnung. Nach beharrlicher Suche fand er ein Terrain am Zugersee. Eine Stiftung wollte ihm ihr Land zur Verfügung stellen. Doch die Bevölkerung musste zuvor darüber abstimmen, ob das Kulturland umgezont werden dürfe. Sie sagte Nein. Zäch suchte weiter und traf schliesslich in Nottwil eine andere Grundstimmung an: Behinderte seien willkommen, erklärten die dortigen Behörden.
Das Zentrum eröffnete 1990. Es zählte 104 Betten, 250 Vollzeitstellen – und keine Normen. Anekdoten aus der Geschichte des SPZ zeigen, dass manches passierte, was in keinem Therapie- oder Pflegeplan stand. Die Patienten bekamen von solchen «Abweichungen» von einem normalen Betrieb wenig oder nichts mit. Oft werden sie davon profitiert haben, dass sich der Gründer und die Mitarbeitenden des SPZ nicht immer den herrschenden Normen unterordneten. Vieles wurde spontan entschieden, ohne dass die Abläufe dokumentiert wurden. Damit liess sich manches schnell und unkompliziert erledigen. Das führte aber auch dazu, dass jedes Mal, wenn jemand seine Stelle verliess, viel Wissen verloren ging.

«Ich versuche eine entspannte Atmosphäre zu schaffen»
Stefan Metzger leitet das Leistungsmanagement des Schweizer Paraplegiker-Zentrums. Im Interview mit Alex Gertschen sagt er, was er mit seinem Team dafür tut.
Stefan Metzger, wann sind Sie am Ende eines Audits zufrieden?
Wenn wir von der Auditorin einerseits Wertschätzung für unsere Arbeit und andererseits gewinnbringende Hinweise erhalten haben.
Was bedeutet das konkret?
Die Auditorin muss sich gut auf unser Unternehmen und das Audit vorbereiten. Während des Audits sollte sie aufmerksam, respektvoll, pragmatisch und konstruktiv sein. Sie darf niemanden in die Pfanne hauen! Und ihre Hinweise müssen für die Branche und unser Unternehmen spezifisch sowie praxisnah sein. Allgemeinplätze bringen uns nichts.
Die Schweizerische Akkreditierungsstelle schaut genau darauf, dass die Auditierenden keine Aussagen mit beratendem Charakter machen. Haben Sie dafür Verständnis?
Das ist uns bewusst und wird von der SQS ja auch immer transparent gemacht. Für eine gute Governance ist die klare Trennung zwischen Auditierung und Beratung sicherlich sinnvoll. Für uns haben auch reine Hinweise auf Verbesserungspotenziale ihren Wert. Entscheidend ist, dass die Auditorin nicht besonders viel mitteilt, sondern ihre Eindrücke konzise zusammenfasst und das Relevante hervorhebt. Das macht eine gute Auditorin aus.
Was macht eine gute Zertifizierungsstelle aus?
Erstens muss sie im Markt bekannt und anerkannt sein. Zweitens muss sie – damit zusammenhängend – stabile Strukturen, Branchenkenntnisse sowie klare und kompetente Ansprechpersonen haben. Drittens ist für eine reibungslose Zusammenarbeit natürlich auch das Backoffice wichtig. Aber entscheidend ist nicht die Zertifizierungsstelle, sondern vielmehr die Auditorin vor Ort.
Und was können Sie für ein gutes Audit tun?
Ich muss dafür sorgen, dass das Audit in einer entspannten und konstruktiven Atmosphäre stattfindet. Dafür ist die Vorbereitung wichtig. Einerseits suchen wir frühzeitig das offene Gespräch mit der Auditorin, um beidseitig die Erwartungen zu klären und unsere Anliegen einzubringen. Andererseits informieren wir die Mitarbeitenden über Sinn und Zweck von Audit und Zertifizierung. Dann planen wir das Audit schlank.
Was bedeutet das?
Wir laden eher wenige Leute ein. Weitere mögliche Auskunftspersonen informieren wir, dass sie im Bedarfsfall ad-hoc hinzugezogen werden. Wer dabei ist, soll sich auch wirklich einbringen können. Entscheidend ist aber natürlich unser Reifegrad: Wir wollen übers ganze Jahr eine Qualität aufrechterhalten, die es uns erlaubt, den Tag des Audits entspannt zu begehen.
Wie vermitteln Sie den Wert von Audit und Zertifizierung?
Wir stellen sie als Mittel zum Zweck dar. Der Zweck sind die Patientensicherheit und generell eine hohe Qualität in der Leistungserbringung. Dafür brauchen wir Übersicht, Klarheit und Verbindlichkeit in den Prozessen. Natürlich verlangt auch die Norm genau diese Dinge! Aber wir argumentieren nie mit ihr, sondern mit der Patientensicherheit und unserem Qualitätsverständnis. Qualitätsmanagement soll nicht eine Frage des Zertifikats, sondern unserer Unternehmenskultur sein. Wenn die Mitarbeitenden begreifen, dass das Audit uns dabei weiterbringt, sind sie auch motiviert mitzumachen.
Joseph Hofstetter kennt die SPS seit 22 Jahren. Zuerst war er ihr Rechtskonsulent, seit zehn Jahren ist er ihr Direktor. Blickt er zurück, war nach einem raschen Wachstum der Stiftung – mit mittlerweile sieben Tochtergesellschaften – um das Jahr 2010 der Zeitpunkt gekommen, um Abläufe zu dokumentieren, zu systematisieren und zu standardisieren. Auch der Druck von aussen war gewachsen: Lange sei es für Firmen bloss ein «Schmuck» gewesen, sich nach den Normen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) zertifizieren zu lassen, sagt Hofstetter. Mittlerweile sei eine Zertifizierung selbst zur Norm geworden.
Hofstetter erinnert sich an Widerstände. Zu Beginn hätten viele Mitarbeitende Vorbehalte gehabt, dass Abläufe kontrolliert werden sollten. Er ist jedoch überzeugt, dass Normen auch für ein unkonventionelles Unternehmen wie sein eigenes eine positive Wirkung haben: «Es hat uns gutgetan, darüber nachzudenken, wie wir arbeiten, und diese Abläufe dann auch von aussen beurteilen zu lassen. Ohne diesen Druck wären wir wohl heute nicht so professionell.»
Die «Qualität», bewusst von der Norm abzuweichen
Wie unterzieht man eine Institution, die ausserhalb der Norm entstand, einer eben solchen? Der Chef der Normen am Paraplegiker-Zentrum, der grössten und wichtigsten Tochtergesellschaft der Stiftung, ist Stefan Metzger. Er leitet das Leistungsmanagement und die Unternehmensentwicklung. Und ausgerechnet er sagt: «Ich bin kein absoluter ISO-Fan. Viele Normen bedeuten nicht automatisch viel Qualität. Es kann auch eine Qualität sein, bewusst von Normen abzuweichen.»
Was er konkret damit meint? «Es ist wichtig, dass wir einen Behandlungspfad systematisieren und ein Standardvorgehen haben, denn dahinter steckt das Wissen, dass dieser Standard gut ist.» Doch dann kommen die Patienten und die Patientinnen ins Spiel: «Sie lassen sich nicht standardisieren, schon gar nicht, wenn sie nicht nur einen Blinddarm operieren müssen, sondern lebenslang eine starke Funktionseinschränkung haben», erklärt Metzger. «Wenn eine Patientin oder ein Patient neun Monate bei uns im SPZ ist, spielt es eine Rolle, wie belastbar die Ehe oder wie jung die Kinder zuhause sind. Deshalb müssen auch die Partnerbeziehung, die Kinder und der Beruf in die Behandlung miteinbezogen werden. Und dafür kann man nicht immer Normen abrufen.»
Räderwerke der Normalität
Dieses Interview ist in voller Länge im Buch «Räderwerke der Normalität. Wie Normen und Standards Vertrauen schaffen» erschienen. Die SQS hat es anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens im Verlag NZZ Libro veröffentlicht. Anhand von Grundlagenartikeln und Fallbeispielen zeigt das Buch auf, wie Normen und Standards es Unternehmen erlauben, hohe Erwartungen zuverlässig zu erfüllen – und so zu einer Normalität beitragen, die alles andere als normal ist. Das Buch ist auf Deutsch sowie – als E-Book – auf Englisch, Französisch und Italienisch erschienen.
Bleiben dann noch Normen übrig, wenn zwar systematisch, aber trotzdem individuell entschieden und behandelt wird? Ja, versichert Metzger. «Bei uns ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass Ärzte, Pflege, Therapie und Hotellerie untereinander in Kontakt sind. Also wird festgehalten, dass sich das Personal dieser Bereiche gegenseitig auf Dinge aufmerksam machen soll, die nicht gut laufen. Und wir legen fest, in welcher Form dies geschieht.»
Normen helfen laut Metzger auch, schneller zu entscheiden: «Viele unserer spezialisierten Ärztinnen und Ärzte fordern uns Qualitätsmanager gerne heraus und möchten diskutieren. Das kann nützlich sein. Aber oft ist es genauso nützlich, einmal sagen zu können: Das ist die Vorgabe, darüber müssen wir nicht jedes Mal von neuem reden.»

Joseph Hofstetter, Direktor der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
Bild: zvg
Fünf Lehren Stefan Metzgers für ein produktives Audit:
- Die Person des/der Auditierenden ist zentral: Arbeiten Sie mit einer zusammen, die gut vorbereitet und während des Audits aufmerksam, respektvoll, pragmatisch und konstruktiv ist.
- Suchen Sie im Vorfeld ein offenes Gespräch mit dem/r Auditierenden, um beidseitig die Erwartungen zu klären und die eigenen Anliegen einzubringen.
- Planen Sie das Audit «schlank»: Laden Sie nur so viele Mitarbeitende ein, wie zeitlich auch zu Wort kommen können. Informieren Sie weitere mögliche Auskunftspersonen, dass sie vielleicht ad-hoc hinzugezogen werden.
- Beugen Sie vor dem Audit bewusst möglichen Ängsten und einer stundenlangen Vorbereitung seitens der Mitarbeitenden vor. Stellen Sie das Audit nicht als risikobehaftete Prüfung dar, sondern als Gelegenheit zur Reflexion – erst allein, dann im Dialog mit dem/r Auditierenden. Die Leitfragen sind: Was ist unser Qualitätsverständnis? Und was tun wir im Alltag, um ihm gerecht zu werden?
- Vermitteln Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen den Wert der Zertifizierung im grösseren Zusammenhang (Qualitätsverständnis, Unternehmenskultur): Wenn sie verstehen, dass das Audit ein Mittel ist, um die wichtigsten Ziele Ihrer Organisation zu erreichen, sind sie motiviert(er) mitzumachen.
Unser Newsletter bringt relevante und interessante Inhalte zu Ihnen
Möchten Sie informiert werden, wenn wir einen neuen Beitrag aufschalten? Dann abonnieren Sie unseren SQS-Blog-Newsletter. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.